ZEPHYR bleibt in Kastennähe
Das ist ganz gut so. Wer von uns Menschen weiß schon, was sich da alles am Himmel bewegt? Da ist die Anwesenheit des territorialen Paars in Horstnähe angesagt…
Danke, Coriena!
Das ist ganz gut so. Wer von uns Menschen weiß schon, was sich da alles am Himmel bewegt? Da ist die Anwesenheit des territorialen Paars in Horstnähe angesagt…
Danke, Coriena!
Danke, Krystyna, danke Coriena für den Mitschnitt!
Danke, Coriena, für diesen clip!
Mir fällt wieder einmal auf, dass die „Platzhalter“ – also z.Zt. das territoriale Paar ZEPHYR & PALATINA sich meist am äußeren Ende der Anflugstange aufstellen, mit der weißen Brust meist zu den schwarz-grauen Schieferschindeln gewendet. Nur selten mit der weißen Brust und Kehle nach vorn! Gerade so, als wollten sie sich etwas tarnen. (Wir Menschen würden uns nie mit dem Gesicht zum Dach aufstellen, nicht wahr?) Heute ist auch das blau-graue Deckgefieder seines Rückens gut zu betrachten.
Wir sahen diese Haltung auch bei den Vorgängern/-innen (AURORA & FRITZ, PHÖNIX, JETTA & PERKEO!
Wir beobachten dabei auch, wie gelenkig eine Falken-Wirbelsäule ist, denn sie haben bei dieser Haltung keinerlei Probleme zu beobachten, was sich hinter ihrem Rücken in der Luft abspielt. Wir Menschen haben 7 Halswirbel, Falken 15!
Danke, Krystyna!
11. 10.2018
 Danke Coriena!
Danke Coriena!
Das werde ich gelegentlich gefragt, meist mit Lob und Anerkennung verbunden, gerade so, als würden Wanderfalken ohne menschliche Unterstützung nicht zur Brut kommen. Vögel gibt es aber seit vielen Millionen Jahren, seit unvorstellbar langen Zeiten in denen es noch keine Menschen gab! Uns gibt es erst seit kurzer Zeit auf dieser Welt und wir erkennen jeden Tag, dass wir der Erde und ihren Bewohnern – gleich ob Pflanzen, Tieren, Klima, Luft und Wasser – wenig Gutes antun. Seit Jahrmillionen kommen die Vögel, auch die Wanderfalken – die es auf allen Kontinenten (außer der Antarktis) gibt – mit der Welt zurecht und haben sich perfekt angepasst.
Alle zehn Falkenarten, die es in Europa gibt (weltweit etwa 38 Arten Falco) bauen selbst kein Nest! Sie legen ihre Eier in eine Baumhöhle, in eine Fels- oder Mauernische oder auf einem Felsband ab. Sie nutzen auch verlassene Nester anderer Vögel, so haben wir auch in Nordbaden seit einigen Jahren eine Brut des Wanderfalken auf einem Baum!
Durch das Freizeitverhalten von uns Menschen, z.B. Klettersport, Gleitschirmfliegen, Geocaching, Grillen, Zelten, Wandern, Drohnenflug, Kajakrudern in Nähe natürlicher Brutplätze (Felswände) des Wanderfalken ist das Brüten dort in den letzten Jahrzehnten für den scheuen Falken schwierig geworden. Selbst wenn die Naturschutzbehörden die Annäherung und das Stören dort verbieten, so halten viele „Naturfreunde“ sich nicht daran.
Dagegen sind die von Menschen angebotenen Nistplätze auf hohen Gebäuden (Hochhäuser, Türme, Brücken) meist für Menschen unzugänglich und deshalb für die Falken sicher. In England gibt es Kirchtürme auf denen seit Jahrhunderten Wanderfalken brüten! Selbst auf sich bewegenden Großbaggern in der Kölner Bucht (Hambacher Wald!) brüten auf rostigen Stahlträgern in großer Höhe Wanderfalken! Bis aus den Eiern die Küken schlüpfen hat sich der Brutplatz auf dem Bagger viele hundert Meter weiter an der Abbaukante bewegt!
Wenn also auf der Heiliggeistkirche kein Nistkasten wäre, würden sich die Wanderfalken eine andere sichere Ecke suchen, vielleicht unter einer hohen Autobahnbrücke oder auf einem hohen Industriebau?
Japan benennt seine Raumsonden „Wanderfalke“, was uns erfreut. „HAYABUSA 2“ hat am Mittwochmorgen aus 51 m Höhe einen 10 kg schweren Kasten MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) auf den steinigen Boden des kohlrabenschwarzen Asteroiden „Ryugu“ fallen lassen. Wegen der schwachen Anziehungskraft des Asteroiden (ein Vierzigtausendstel der irdischen Gravitation) ist das in Bremen zusammen geschraubte Forschungsgerät sehr sanft gelandet.
Heute ein Blick vom „Rindenhäuschen“ auf die Altstadt aus einer Höhe, in der wir die Falken oft kreisen sehen. Dass sie dabei – aus dieser Höhe – genau erkennen, welcher Vogel dort unten eventuell als Beute dienen könnte, bleibt uns unvorstellbar. Aus dieser Höhe und von diesem Blickwinkel haben sie auch direkten Einblick in den Nistkasten .

Danke Krystyna!
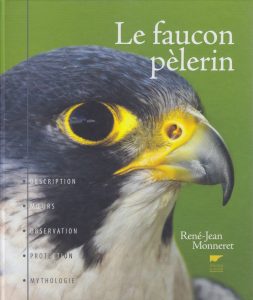 dann kann er etwas berichten, sagte meine Oma.
dann kann er etwas berichten, sagte meine Oma.
Ich hatte in drei Wochen Ferien in Frankreich die Gelegenheit, ein schönes Falkenbuch zu kaufen und am Pool des Ferienhauses zu lesen. (Gelegentlich unterbrochen, um Turmfalken zu beobachten, die jeden Tag auf den Wiesen nebenan jagten.)
René-Jean Monneret ist – neben den Brüdern J.F. u. M.Terrasse – der bedeutendste Falkenkenner Frankreichs. Auf 240 Seiten stellt er in 10 Kapiteln den Wanderfalken vor, illustriert mit herrlichen Fotos und guten Zeichnungen. Mir gefällt seine ausführliche Beschreibung des Fluges und des Jagdverhaltens des Wanderfalken. Monneret, heute über 80 Jahre alt, hat seit den frühen 1960-er Jahren die Wanderfalken vor allem im französischen Jura beobachtet, studiert und geschützt. Er berichtet in seinem Buch über Niedergang und die Rückkehr des Wanderfalken in Frankreich. Die Wiederansiedelung verlief parallel zu den Daten, die wir aus Deutschland kennen.
Wenig überraschend berichtet Monneret nur über die französischen Wanderfalken. Auch in der angegebenen Bibliographie finde ich wenige deutsche Namen. Monneret erinnert an die Aushorstungen durch deutsche Falkner in den 1960-er Jahren im Jura, die dort bis zu einem Drittel der Wanderfalkenpopulation wilderten. (Ich selbst hatte in den späten 1960-er Jahren Kontakt zu einem Förster, in dessen Revier bei Baerenthal, nahe der Grenze zu Deutschland, ein Horst bewacht werden musste.)
Auch in Frankreich wurde durch Horstbewachung, Adoption von Küken – aus Zuchten – durch wild lebende Paare der Wanderfalke gerettet. Im Osten und im Süden Frankreichs ist er wieder gut vertreten. Auch in den Städten gibt es nun auf Gebäuden nistende Paare, wie wir es als Heidelberger kennen. ( Im nahen Périgueux nannte man mir vor einer Woche einen Nistkasten auf der Kathedrale Saint- Front!)
Monneret schätzt die Zahl der 2017 in Frankreich lebenden Paare auf 1 500 bis 2 000.
Dem Schlusskapitel von Monneret, dem er den Titel „Observer- comprendre – et laisser vivre“ gibt, stimmen wir aus Heidelberg zu: „Beobachten – verstehen – leben lassen!“
Réne-Jean Monneret, Le faucon pèlerin, www.delachauxetniestle.com
Description, Mours, Observation, Protection, Mythologie
2017 ISBN 978-2-603-02454-6 24,90 EURO (en France)